[Rezension]
In „Weiße Tränen” zeigt Kathrin Schrocke aus der Sicht des 16-jährigen weißen Ich-Erzählers Lenni, wie tief Rassismus in unserer Gesellschaft verankert ist. Das ist ein ungewöhnlicher Zugang, den es bisher im deutschen Jugendbuch nicht gab.
Ehrlich gesagt war ich vor dem Lesen skeptisch, weil das Thema Rassismus so dominant platziert ist. Das Cover spiegelt es mit der Black-Power-Faust sehr deutlich, Titel und Klappentext benennen es zusätzlich. Außerdem richten sich viele Leseempfehlungen an Lehrende. Ich hatte befürchtet, der Inhalt könnte mit einem erhobenen pädagogischen Zeigefinger erzählt sein, der literarisch geschickt verpackt ist. Wie ich mich getäuscht habe!
Kathrin Schrocke geht ihr Thema so sensibel und klug an, dass ich beim Lesen in einen Sog geriet, der mich bis zum Ende nicht mehr losgelassen hat. Ich fand mich in einer Geschichte wieder, die lebendig erzählt ist, in der mehrdimensionale Figuren die Konflikte vorantreiben und die Zwischentönen Raum gibt. Das ist gute Literatur und spannende Unterhaltung! Diese Geschichte fordert uns alle, Jugendliche wie Erwachsene, dazu auf, Stellung zu beziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Worum geht es?
- Das Besondere an diesem Roman
- Statements der Autorin
- Für wen empfehle ich dieses Buch?
- Handreichung für den Unterricht
Worum geht es?
Sechs Jugendliche – Alex, Benjamin, Elif, Lenni, Luisa und Serkan – heben ein Loch unter einer alten Eiche aus, um eine Urne beizusetzen. Da nähern sich plötzlich die blauen Lichter von drei Polizeiautos. Die Autos kreisen die Jugendlichen ein und beleuchten die Szene gespenstisch mit Scheinwerfern.
Jetzt sind sie geliefert!
Zum Glück hat Benjamin sich gerade in die Büsche geschlagen.
Zum Glück? Anscheinend hat es etwas mit seiner Hautfarbe zu tun. Aber warum? Was ist geschehen?
Wir erfahren es erst am Ende. Der Prolog endet mit einem Cliffhanger.
Schrocke blendet über an den Frühstückstisch von Lennis Familie, die in einem kleinen Ort im Schwarzwald zu Hause ist. Die Eltern des 16-jährigen Ich-Erzählers führen dort ein Bestattungsunternehmen. (Noch eine sehr ungewöhnliche Wahl der Autorin! Aber plötzlich erscheint die Urne aus der Eingangsszene nicht mehr ganz so skurril.)
Es ist der erste Schultag. Lenni freut sich, seinen besten Freund Serkan an der Schule zu treffen. Doch welche Überraschung! Auf der Treppe vor dem Haupteingang wartet ein neuer Schüler.
S. 15
Unter dem Schriftzug „Kant-Gymnasium” stand der schwärzeste Junge, den ich jemals gesehen hatte. Sein Outfit irritierte mich. Er steckte in einem gebügelten weißen Hemd mit schicker, schmaler Krawatte. Bei jedem anderen hätte diese Aufmachung unpassend gewirkt. Aber der Typ trug dazu einen beeindruckenden Afro. Bestimmt war er ein begnadeter Tänzer.
Der Typ heißt Benjamin Schneidmüller, ist mit seinen Eltern vor zwei Wochen neu zugezogen und kommt in dieselbe Klasse wie Lenni und Serkan. Herr Prasch, Lennis Lieblingslehrer, fragt Benjamin denn auch gleich, woher er komme. Benjamins kurze Antwort, er komme aus Leipzig, genügt Herrn Prasch nicht:
„Ich meine, wo kommst du wirklich her? (…) Somalia oder Ghana vermute ich?”
S. 23
Als Benjamin antwortet, er sei in Leipzig geboren, ebenso wie seine Mutter, gibt der weiße Herr Prasch den „schwarzen Ossi” der Lächerlichkeit preis. Doch Benjamin weiß sich zu behaupten und dreht den Spieß einfach um, indem er Herrn Prasch fragt, woher er denn komme. Die gesamte Klasse hält den Atem an. Noch nie hat es irgendjemand gewagt, so mit Herrn Prasch zu sprechen. Dieser reagiert dann auch prompt beleidigt. Schließlich hätte er doch nur nett sein wollen! Und Benjamin solle seinem Gegenüber nicht immer gleich das Schlechteste unterstellen.
Die Situation eskaliert, als Herr Prasch in der Theater-AG verkündet, sie wollten in diesem Schuljahr das Musical „King Kong” inszenieren. Beim Vorsingen glänzen Serkan und Alex gleichermaßen, doch dann entscheidet Herr Prasch, dass Alex die männliche Hauptrolle bekommen soll und Serkan die Rolle von King Kong, bei der er nicht einmal sprechen muss.
Serkan ist total enttäuscht. Auch für Lenni fühlt sich die Entscheidung irgendwie nicht gut an, aber er kann nicht richtig fassen, warum. Benjamin ist der Einzige, der sich empört – nicht nur wegen des rassistischen Hintergrunds des Musicals, sondern auch wegen der Rollenvergabe:
„Sie geben dem einzigen Schüler der AG, der nicht weiß ist, ernsthaft die Rolle des Affen?”
S. 55
Wutentbrannt verlässt Benjamin die Schule – und taucht die nächsten Tage nicht wieder auf. Die Sache nimmt auch ohne ihn ihren Gang.
Kathrin Schrocke muss ein großes Kompliment gemacht werden, wie es ihr gelungen ist, die Konflikte nach und nach zuzuspitzen. Lenni, der sich genau wie Herr Prasch und alle anderen anfangs frei von jeglicher rassistischer Haltung wähnt, realisiert nach und nach, welche Nachteile sein Freund Serkan und dessen Schwester Elif tagtäglich erfahren, welchen Vorurteilen sie ausgesetzt sind und inwieweit sein eigenes Verhalten dazu beiträgt.
Am Ende ist nicht alles gut, so viel möchte ich verraten. Aber vor allem Lenni hat einiges verstanden, auch wenn noch viel Luft nach oben bleibt.
Das Besondere an diesem Roman
Der Blick auf weiße Privilegien
Der Begriff „White tears” (Weiße Tränen) geht auf den gleichlautenden Titel des 2017 erschienenen Romans von Hari Kunzru zurück. Der britische Autor hat diesen in den USA ironisch verwendeten Begriff aufgegriffen, der die heftigen Reaktionen von wütenden, beleidigten oder ignoranten Weißen umschreibt, wenn sie darauf angesprochen werden, dass ihre Äußerungen und Verhaltensweisen rassistisch sind und die Gefühle von nichtweißen Menschen verletzen.
Ein solches Verhalten beobachten wir im Roman bei Herrn Prasch, aber auch bei Luisa und anderen Schüler:innen. Sie reagieren sehr vehement, als Benjamin ihnen Rassismus vorwirft. Wie er nur so etwas behaupten könne, schreien sie empört auf. Sie seien ganz bestimmt nicht rassistisch. Das wüssten doch alle! Und außerdem sei das doch alles gar nicht so gemeint gewesen.
Kathrin Schrocke macht deutlich, wie die Beschuldigten durch solche abwehrenden Äußerungen die Vorwürfe von Rassismus und Diskriminierung im Keim zu ersticken versuchen, indem sie Empathie für sich selbst fordern. Das führt zu einer Täter-Opfer-Umkehr, aufgrund derer letztendlich nicht mehr über das Thema, sondern nur noch über vermeintliche Verletzungen gesprochen wird. Auf solche Weise ändert sich natürlich gar nichts.
Aktualität und Zeitbezug
Dieser Roman könnte aktueller nicht sein. Die Geschichte spielt im Jahr 2016, was nur deshalb von Bedeutung ist, weil sich seitdem viel ereignet hat. Denkt zum Beispiel an die Ereignisse von Hanau, als ein weißer Deutscher neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hat, oder an die gewaltsame Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA.
Diese Ereignisse haben gesellschaftliche Debatten angestoßen. Aber hat sich seitdem und dadurch wirklich etwas geändert?
Während die großen öffentlichen Proteste nach den Anschlägen von Hanau ausblieben, gingen auch in Deutschland Hunderttausende wegen eines Mordes auf der anderen Seite des Atlantiks auf die Straße. Ein weiterer Schlag ins Gesicht der Opfer und Angehörigen von Hanau – und ein deutlicher Hinweis darauf, wie dringend wir uns als Gesellschaft mit dem in Deutschland wurzelnden Rassismus auseinandersetzen müssen. Dieses Buch kann einen Beitrag dazu leisten.
Statements der Autorin
Ich hatte das Glück, Kathrin Schrocke am 12. April 2024 bei einem Online-Werkstattgespräch der „Deutschen Akademie für Kinder und Jugendliteratur” erleben zu dürfen. Die Autorin hat dort erzählt, dass ihr von Anfang an sehr bewusst gewesen sei, wie heikel es sei, wenn sie als weiße, deutsche Frau über Rassismus schreibe, denn ihr persönlich fehle die Rassismuserfahrung. Bevor sie mit dem Schreiben begonnen habe, habe sie deshalb sehr viele Gespräche mit Betroffenen geführt, Podcasts gehört, Fachliteratur und Erfahrungsberichte gelesen sowie verschiedene Anti-Rassismus-Trainings besucht.
Im Nachwort ihres Buches schreibt sie:
Ich habe mich (…) intensiv mit Themen wie weißer Zerbrechlichkeit und den berühmten Tränen der Weißen auseinandergesetzt – auch mit meinem eigenen, tief sitzenden Rassismus. Ich bin überzeugt davon, dass man als weißer Mensch wegen der gesellschaftlichen Prägung gar nicht anders kann, als rassistisch zu sein.
S. 217
Daher war es ihr auch ein großes Anliegen, ihren Schreibprozess von zwei Sensitivity-Readerinnen begleiten zu lassen, sagte Kathrin Schrocke im obigen Online-Seminar. Da das für die Verlage heutzutage leider noch nicht selbstverständlich sei, auch nicht bei solchen Themen, habe sie ihre Sensitivity-Readerinnen anfangs vollständig aus eigener Tasche bezahlt, später dann „nur noch” in Teilen, weil der Verlag letztendlich doch einen Zuschuss gewährt habe.
Es sei ihr nicht leicht gefallen, dieses Buch zu schreiben. Immer wieder habe sie den Text beiseitelegen müssen, um einen möglichst unvoreingenommenen Blick auf Handlung, Figuren und Text zu bewahren.
Für wen empfehle ich dieses Buch?
Der Verlag empfiehlt dieses Buch für alle ab 13 Jahren, ich würde es wegen des Themas eher etwas Älteren ans Herz legen. Das Buch lässt sich gut lesen, erfordert mit seinen 224 Seiten aber ein bisschen Durchhaltevermögen. Inhaltlich bietet der Roman so viel Potenzial, dass ich ihn mir auch als gemeinsame Lektüre für Buchclubs oder Familien vorstellen kann.
Kathrin Schrocke selbst hat in dem oben bereits erwähnten Online-Gespräch berichtet, dass sie durchaus schon vor 7. Klassen gelesen habe und ihre Lesungen auch dort gut angenommen worden seien. Die intensiveren Auseinandersetzungen aber erlebe sie bei Lesungen ab der 9. Klasse, weil die Schüler:innen deutlich besser ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus reflektieren könnten und inhaltlich weniger überfordert seien.
Handreichung für den Unterricht
Hinweisen möchte ich noch darauf, dass der Mixtvision-Verlag eine Handreichung für den Unterricht online gestellt hat, die ich sehr gelungen finde. In dieser Handreichung gibt es nicht nur konkrete Aufgabenstellungen mit Lösungen. Auch die möglichen Probleme, die die Behandlung des Themas im Unterricht mit sich bringen, werden angesprochen und sind mit praktischen Hinweisen versehen. Miriam Rosenlehner, die Autorin der Handreichung, unterrichtet als Lehrerin in Bayern, ist als Lehrbeauftragte an der Hochschule Augsburg tätig und hat Kathrin Schrockes Roman „Weiße Tränen” als Sensitivity-Readerin begleitet.
Ihr findet die Handreichung auf der Homepage des Verlages.
HANDREICHUNG FÜR DEN UNTERRICHT
»Weiße Tränen« von Kathrin Schrocke
Autorin: Miriam Rosenlehner
Klasse 8–10, ca. 13–16 Jahre
(Heinke Ubben, 23.4.2024)
Rezensiert wurde:
Weiße Tränen
Kathrin Schrocke
Mixtvison-Verlag: München 2023, 2. Aufl.
ISBN: 978-3-95854–205-1
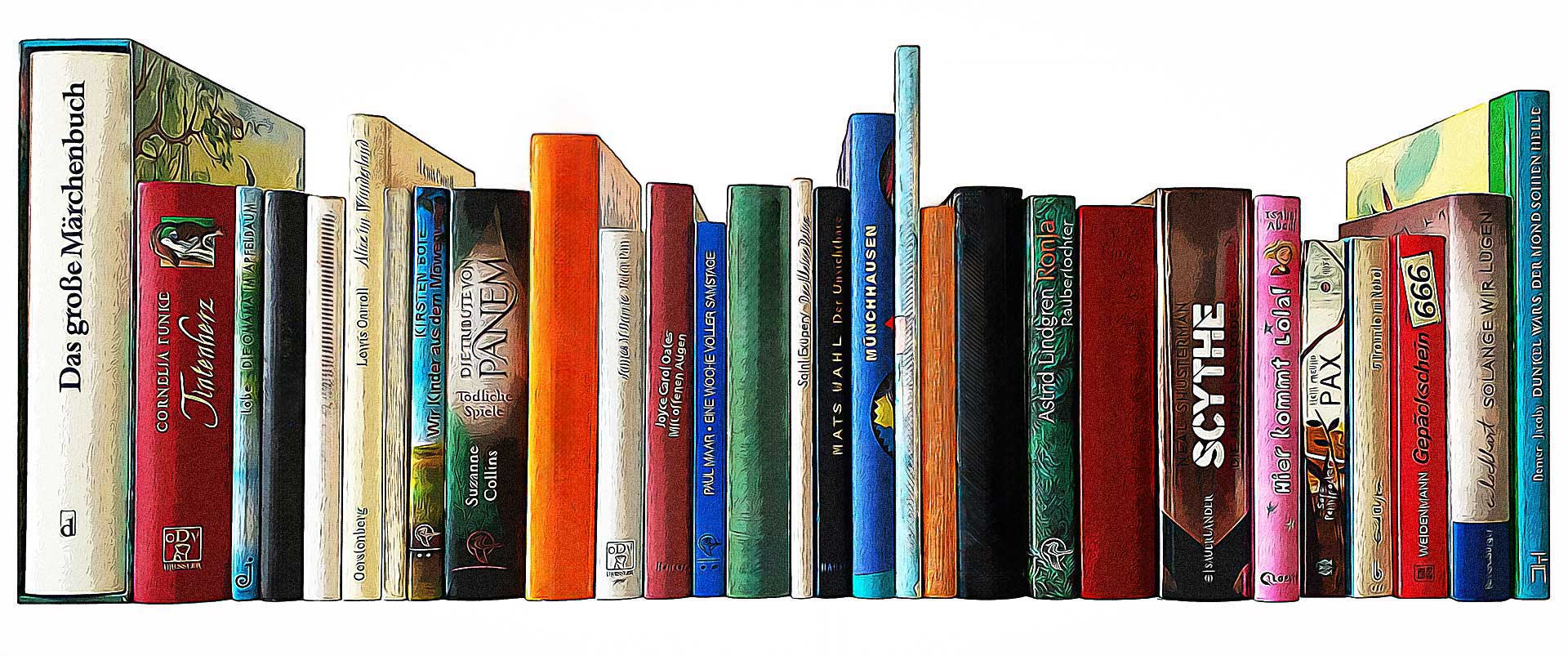

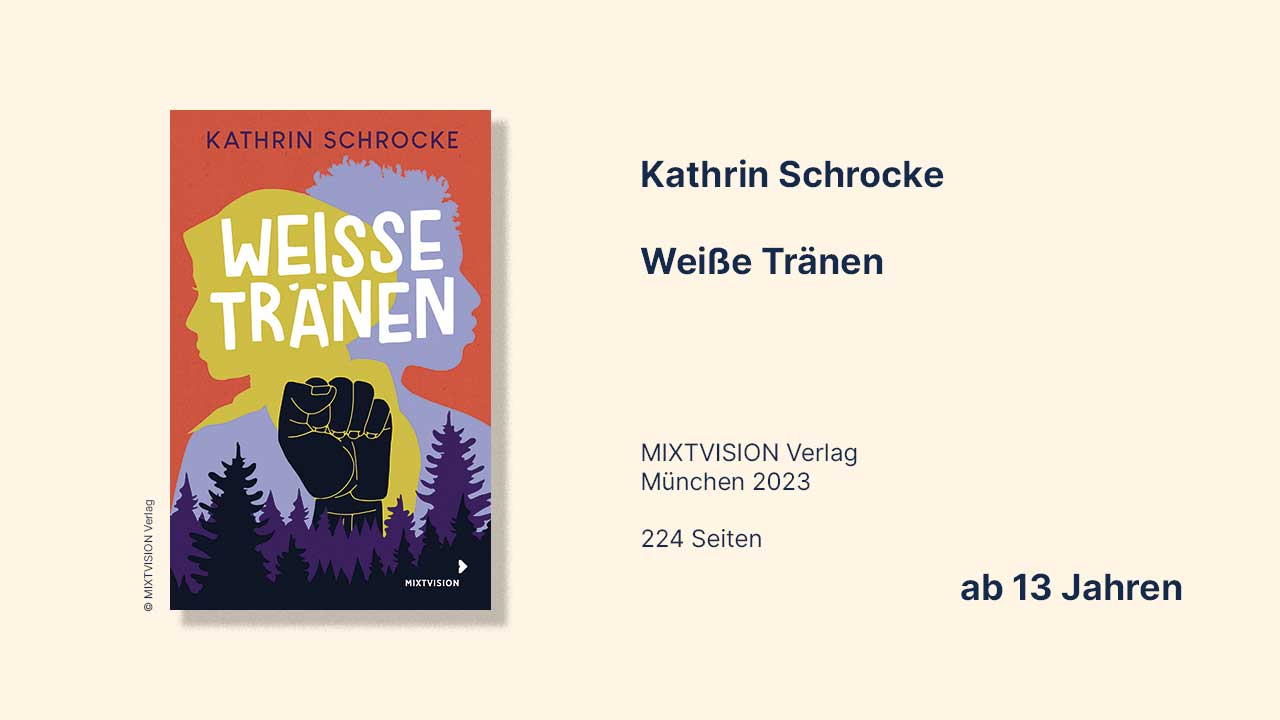
Schreibe einen Kommentar