[Rezension]
„Birdie und ich“ von Jessica M. M. Nuanez besticht von der ersten Seite an durch schillernde Figuren und eine sensible und bildreiche Sprache. Das darf gern wortwörtlich genommen werden, denn Birdie, der neunjährige Bruder der Ich-Erzählerin Jack, liebt seine von Glanzfäden durchzogene lila Wutmütze genauso wie leuchtende Kleidung und auffälligen Nagellack. Und auch Onkel Carl hat seinen ersten Auftritt im goldglänzenden Boxermantel.
Natürlich tragen nicht alle Figuren ein extravagantes Äußeres. Das wäre ja auch langweilig! Onkel Patrick, der dem jüngeren Onkel Carl wie aus dem Gesicht geschnitten ist, kann mit Baseballkappe, kariertem Hemd, Jeans und Arbeitsstiefeln durchschnittlicher und unauffälliger nicht sein. Auch Jack, die Ich-Erzählerin, mag ihre Kleidung lieber zurückhaltener. Eine Strahlkraft haben aber auch sie, denn alle Figuren, selbst die Nebenfiguren, sind so komplex und individuell angelegt, dass sie wie ein Kaleidoskop leuchten.
Dabei haben es die Figuren in diesem Roman nicht leicht.
Inhaltsverzeichnis
- Worum geht es?
- Das Besondere an diesem Roman
- Preise und Auszeichnungen
- Für wen empfehle ich dieses Buch?
Worum geht es?
Vor zehn Monaten ist die Mutter von Jack (12) und Birdie (9) gestorben, worüber Jessica M. M. Nuanez anfangs kaum Worte verliert, denn nicht die Gefühle von Trauer und Schmerz stehen in diesem Roman im Vordergrund, sondern die Erinnerungen der Kinder an Vertrautes, ihre Verlusterfahrungen und ihr Neubeginn inmitten von Menschen, die die Kinder nicht kennen.
Die Abwesenheit der Mutter ist dennoch ständig präsent. So stellt uns die Autorin Birdie gleich zu Beginn als einen Jungen vor, der „Mamas alten lila Lidschatten“ (S. 7) trägt. Nur wenige Zeilen später bringt sie seine Bewunderung für Audrey Hepburn zum Ausdruck, die Jack und Birdie wegen Mamas „Leidenschaft für alte Filme“ (S. 8) kennen.
Im Rückblick erfahren wir, dass die Kinder nach dem Tod der Mutter zunächst einige Tage bei einer lieben, alten Nachbarin lebten, bevor Onkel Patrick auftauchte, den sie nie zuvor gesehen hatten. Nicht nur mit seiner „Bergstimme“ wird er als unerreichbar beschrieben. Die Ich-Erzählerin Jack sagt:
Es war fast so, als wäre er gekommen, um ein teures Familienerbstück entgegenzunehmen – schon etwas Wichtiges, Bedeutendes, aber auf jeden Fall nichts Lebendiges. Nicht seine Nichte und seinen Neffen.
S. 14
Onkel Patrick verfrachtet die Kinder in einer siebenstündigen Autofahrt in ein „Kaff im nordkalifornischen Nirgendwo“ (S. 163) und liefert sie bei seinem Bruder Carl ab, den die Kinder immerhin von seinen wenigen Besuchen, von Fotos und aus Erzählungen der Mutter kennen.
Ihr gutmütiger Onkel Carl, selbst noch ein großes Kind, teilt seine zentral gelegene, kleine Wohnung mit den beiden, verwöhnt sie mit Honey Bunny Beans (Zimtknoten) und Eisbechern und lässt ihnen viel Raum, sodass vor allem Birdie sein darf, wie er ist. Zu viel Raum befindet das Jugendamt, denn leider hat Birdie zahlreiche Fehltage in der Schule.
Außerdem hat Onkel Carl aus Wut einen Stuhl nach Birdies Lehrerin geworfen – wie wir später erfahren. Da verwundert es wenig, dass die Lehrerin ihn als untauglichen Erziehungsberechtigten dem Jugendamt gemeldet hat.
Soweit also die Ausgangssituation. Nun müssen die Kinder innerhalb von zehn Monaten eine zweite Veränderung hinnehmen und von Onkel Carl zu Onkel Patrick ziehen. Er lebt etwas außerhalb in einer grauen, dämmrigen „Schuhschachtel“ (S. 18), die sich nach und nach als das Elternhaus ihrer Mutter und der beiden Brüder entpuppt – darum aber nicht heimischer wird.
Dabei ist bei Patrick nicht alles schlecht. Endlich haben die beiden wieder ein eigenes Zimmer und ein richtiges Bett – bei Onkel Carl musste Jack „auf einem Futon am Boden (…) neben einer abgewrackten Couch“ (S. 35) schlafen, auf der Birdie lag. Außerdem backt Patrick duftendes Brot und versorgt sie mit gesundem Essen, das sie bei Carl so vermisst haben, von zu Hause aber sehr wohl kennen.
Emotional ist Patrick mit seiner Nichte und seinem Neffen allerdings total überfordert. Das liegt einerseits an seinem Naturell, denn er redet auch sonst kaum; andererseits an einem Ereignis, das erst gegen Ende beschrieben wird und deshalb an dieser Stelle nicht verraten werden soll. Nur so viel: Patrick fühlt sich schuldig, während die Kinder davon überzeugt sind, dass er sich gar nicht für sie interessiere.
Als Birdies Lehrerin Patrick dann auch noch davon überzeugt, dass Birdies auffällige Klamotten die Ursache für seine Schul-Probleme sind, spitzt sich die Lage weiter zu.
Bei Mama durfte Birdie immer anziehen, was er wollte. Röcke oder Kleider zieht er nie zur Schule an, er sagt, sie seien unpraktisch, wenn man Dodgeball spielen will, ein anderes seiner Hobbys. Trotzdem fällt den meisten Leuten auf, dass Birdie sich anders anzieht, als die meisten Jungen. Aber bis jetzt sind seine rosa oder lila T-Shirts, seine Schuhe in Regenbogenfarben und die Leggings mit einem Muster aus rosa Donuts und all das nie ein echtes Problem gewesen.
S. 30
Aber deswegen war es auch noch nie ein Problem, Birdie dazu zu bewegen, zur Schule zu gehen.
Dieses Zitat verdeutlicht, worum es der Autorin in diesem Roman eigentlich geht. Jack und Birdie nämlich lieben Birdies bunte Kleidung. Sie gehört zu ihm wie seine Nase und Ohren. Deshalb ist seine Kleidung auch kein Problem für sie und ist auch nie eines gewesen. Es sind die anderen, die ein Problem damit haben! Und diese anderen erwarten, dass Birdie sich ändert! Das ist großartig angelegt und beschrieben. Ich kenne kein anderes Kinder- oder Jugendbuch, in dem das Thema Diversität aus diesem Blickwinkel verhandelt wird.
Das Besondere an diesem Roman
Der Umgang mit dem Thema Diversität
Dieses Buch hält allen queerfeindlichen Menschen einen Spiegel vor. Die Kinder verstehen nämlich gar nicht, warum Birdie sich ändern sollte. Warum sollte plötzlich anders sein, was jahrelang überhaupt kein Problem war? Früher war Birdie der Liebling seiner Lehrerin, die neue aber verbietet ihm als Allererstes, sein „Täschchen“ mit in den Unterricht zu nehmen.
Auch Patrick verlangt irgendwann von Birdie, sich „normal“ zu kleiden. Birdie aber will keine anderen Kleidungsstücke. Doch er kann sich nicht weigern. In seiner Not erfindet er kurzerhand einen Jungen namens „Norman“, der nur öde, graue Kleidung trägt. Allein diesem Norman zuliebe probiert (und trägt) Birdie diese neue Regenwolken-Kleidung.
Natürlich ändert sich dadurch überhaupt nichts – außer dass Birdie leidet. Er hasst diesen Norman und wird weiter gemobbt. Mit sich selbst dagegen ist Birdie im Reinen. Er weiß genau, was er will und lässt sich von Patrick weder abhalten, in seinem „Buch der fabelhaften Ideen“, einem Ordner mit selbst gestalteten Ausschnitten aus Modezeitschriften, zu schmökern noch seine alten Kleider zu tragen. Sobald sich die Gelegenheit ergibt, wirft er die graue Norman-Identität ab und wird wieder zu dem Farben liebenden, fröhlichen Birdie.
Es ist sehr gelungen, dass die Autorin aus dieser Geschichte keine Selbstfindungsgeschichte macht. Nur an einer einzigen Stelle fragt die 14-jährige Janet Birdie, ob er das Gefühl habe ein Mädchen zu sein. In diesem Kontext fallen auch die Begriffe „Transgender“ und „schwul“. Aber Birdie weiß es nicht und fragt:
Ist es schlimm, dass ich das nicht weiß?
S. 210.
Natürlich ist das nicht schlimm. Mit neun Jahren muss man schließlich noch nicht alles wissen, auch wenn es andere geben mag, die andere Erfahrungen gemacht haben. In diesem Roman geht es nicht darum herauszufinden, was eine:r ist. Es geht darum, dass es okay ist, so zu sein, wie jede:r ist. Und so lässt J. M. M. Nuanez Jack denn auch sagen:
Ich weiß nur eins: So wie er ist, ist Birdie völlig in Ordnung.
Ebd.
Kann es eine schönere Botschaft geben? Ich finde nicht.
Figuren mit Ecken und Kanten
Dieser Roman ist eine Geschichte von Außenseiter:innen, in der Schwarz-Weiß-Zeichnungen und Kategorisierungen vermieden werden. Dadurch entstehen Widersprüche, die Spannung aufbauen. Manch eine:r mag eine solche Wirklichkeit als hart oder traurig beschreiben. Aber das Leben ist nicht immer golden. J. M. M. Nuanez nimmt ihre Figuren ernst und beschreibt sie mit all ihren Ängsten, Nöten sowie ihren guten und schlechten Erfahrungen.
Die empathische Ich-Erzählerin Jack, aus deren Perspektive wir die Geschichte hören, ist eine scharfe Beobachterin. So hat ihre Mutter sie gesehen und so versteht sie sich auch selbst. Erwähnenswert ist ihr Notizbuch mit Listen, aus dem wir einzelne Einträge als Einschübe zwischen den Kapiteln zu sehen bekommen. Anfangs sind es überwiegend Listen von Dingen, worunter eine quergedruckte typografisch besonders auffällt, die mit „Dinge in Mamas Haus – Inventarliste“ (S. 72) überschrieben ist; später beschreibt Jack zunehmend Veränderungen und notiert ihre Gedanken und Gefühle.
Schon gleich bei ihrer Ankunft im „Pampakaff“ lernt Jack Janet kennen, die Onkel Carl als den „Schrecken der Straße“, manchmal auch als den „Schrecken der Stadt“ betitelt. Janet ist ein „Tornado“ und gibt der Figurendynamik ordentlich Schwung, denn Janet ist direkt, bringt Dinge auf den Punkt und sagt ihre Meinung. Jack findet Janet anfangs so „gewöhnungsbedürftig wie Sushi“ (S. 34).
Auch Janet hat ihre Probleme. Sie lebt mit ihrer Mutter, die kaum zu Hause ist, in einem Trailer und setzt alles daran, um Frisörin zu werden und in einem Salon im Ort arbeiten zu dürfen.
Die wohl zwiespältigste und widersprüchlichste Figur in diesem Roman ist Patrick. Carl nennt ihn eine „Auster“, den „Ziegenbock“ oder den „Alten“. Birdie bezeichnet ihn als „Maschinenflüsterer“, Janet an einer Stelle sogar als „Gefängniswärter“. Am Anfang halten ihn Lesende vermutlich für kaltherzig, erst sehr spät wird deutlich, was er im Hintergrund und ohne große Worte für alle anderen tut.
Onkel Carl dagegen sticht von Anfang an als gefühlsduseliger und unreifer Erwachsener heraus, zum Beispiel wenn er um Marlboro, seine verstorbene (und ausgestopfte) Echse, so sehr trauert, dass er Termine vergisst. Er ist in Rosa verliebt, die auf der anderen Straßenseite einen Imbisswagen betreibt. Rosa spiegelt ihm seine Unzuverlässigkeit, indem sie seine ständigen Heiratsanträge mit der Begründung ablehnt, dass sie sich auf ihn nicht verlassen könne.
Und dann ist da noch Krysten, das einzige schwarze Mädchen an der Schule und wie Jack eine „Insel“. Ihre Familie ist erst vor fünf Jahren zugezogen und noch immer nicht im Ort integriert. Ein Referat, das Jack und Krysten gemeinsam halten sollen, bringt die beiden zusammen.
Abgeschlossen wird der Figurenreigen mit dem gewalttätigen Ross und seinem nicht weniger gewalttätigen Sohn Teddy, die keine Gelegenheit auslassen, über Birdie herzuziehen und ihn zu attackieren. Sie sind die einzigen Figuren, die sich im Verlauf der Handlung nicht ändern.
Poetische Sprache und bildreiche Ideen
Nicht nur bei den Figuren entsteht der Eindruck, die Autorin kenne sie persönlich. Auch andere Dinge werden so anschaulich geschildert, dass wir sie bildlich vor Augen haben. Da ist zum Beispiel der Siloschuppen, ein großes, rundes Gebäude im Vorgarten, das wie ein Ufo aussieht und Patricks Rückzugsort zu sein scheint. Das Silo umgibt eine geheimnisvolle, fast außerirdische Aura. Aber weil in einem Roman natürlich nichts nicht von Bedeutung ist, verweist diese frühe Beschreibung tatsächlich auf einen (fast) unwirklichen Ort. Aber davon erfahren wir erst am Ende.
Auch in anderen Kontexten findet die Autorin sprechende Bilder. Ich persönliche liebe die Wortschöpfung Wolfstage. Wolfstage waren eine Erfindung der Mutter und umschreiben Tage mit Abenteuern, an denen die Kinder und sie spontan etwas Besonderes unternommen haben.
Dieses ungeheure Sprachgefühl und die feinsinnigen Beschreibungen der Autorin, Jessica M. M. Nuanez, und ihrer Übersetzerin, Birgitt Kollmann, tragen den gesamten Roman. Jedes Wort spiegelt ihre Freude an der Sprache. Durch die Sprache werden die Persönlichkeiten in diesem Roman lebendig. Die Gefühle der Figuren spiegeln sich in gelungenen, oft überraschenden Sprachbildern und Vergleichen. Auf diese Weise erschaffen Autorin und Übersetzerin eine einzigartige Welt und Wirklichkeit, in der auch Gegensätze ihren Platz haben (dürfen).
Coverabbildung
Das Bild des Covers illustriert den Kern des Inhalts in ganz besonderer Weise. Vermutlich wurde es deshalb vom amerikanischen Original übernommen und nur im Titel angepasst. Die Illustration stammt ursprünglich von Jessica Jenkins. Darauf spannt Jack einen Schirm auf, der sie und Birdie schützt, während um sie herum bunte Regentropfen fallen. Wer ganz genau hinschaut, entdeckt auch einen bunten Heißluftballon, der in den Himmel aufsteigt und im Roman eine zentrale Rolle spielt.
Preise und Auszeichnungen
- Die Besten 7, November 2022, Deutschlandfunk
- LUCHS, eine Auszeichnung der Wochenzeitung „Die Zeit“ und von Radio Bremen, August 2022
- Auswahlliste zum Deutschen Kinder- und Jugendliteraturpreis 2023 in der Sparte Kinderbuch
- Die Übersetzerin Birgitt Kollmann wurde aufgrund ihrer hervorragenden und poetischen Übersetzung von „Birdie und ich“ in die IBBY Honour List 2024 aufgenommen.
Für wen empfehle ich dieses Buch?
„Birdie und ich“ richtet sich an Leser:innen, die gern und viel lesen und/oder sich mit dem Thema Diversität auseinandersetzen möchten. Kinder und Jugendliche, die fast ausschließlich wegen der Spannung und aus Gründen der leichten Unterhaltung lesen, werden mit diesem Buch überfordert sein bzw. sich langweilen.
„Birdie und ich“ ist kein Text, durch den man sich wohlig treiben lassen kann. Er ist ein Roman mit bildreicher Sprache, großartig charakterisierten Figuren und einem zentralen Anliegen, bei dem auch Kinder und Jugendliche spüren werden, dass sie einen ganz besonderen Text vor sich haben.
Die Verlagsempfehlung richtet sich an Kinder ab 11 Jahren. Für viellesende Kinder passt das, aber verschenken würde ich das Buch lieber an 12- oder 13-jährige. In der Schule ist das Buch, je nach Lesekompetenz, wohl eher für die 7. oder 8. Klasse zu empfehlen statt für die Unterstufe.
Teilst du diese Einschätzung? Schreib deine Erfahrungen mit dem Buch gern in die Kommentare!
(Heinke Ubben, 9.4.2024)
Rezensiert wurde:
Birdie und ich
J. M. M. Nuanez
Aus dem Englischen von Birgitt Kollmann
dtv Verlag: München 2022
ISBN: 978-3-423-64095-4
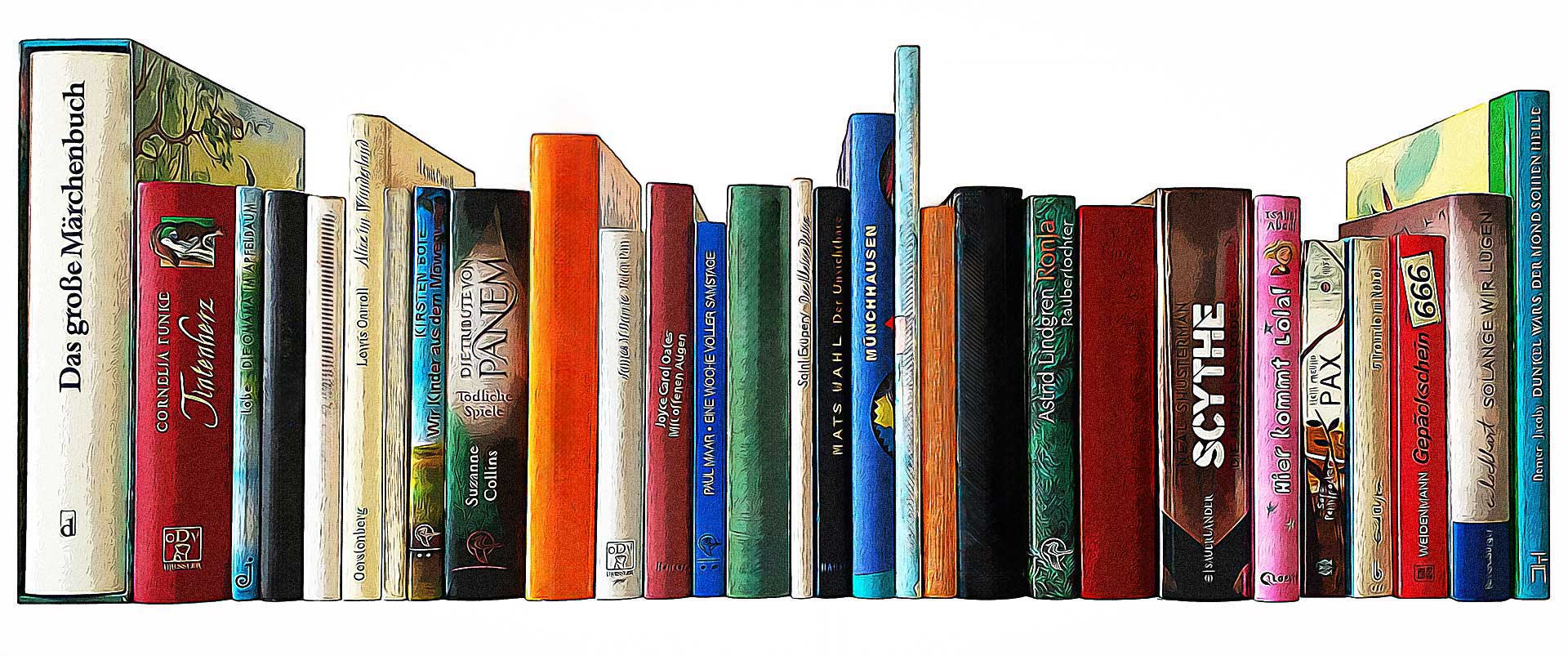

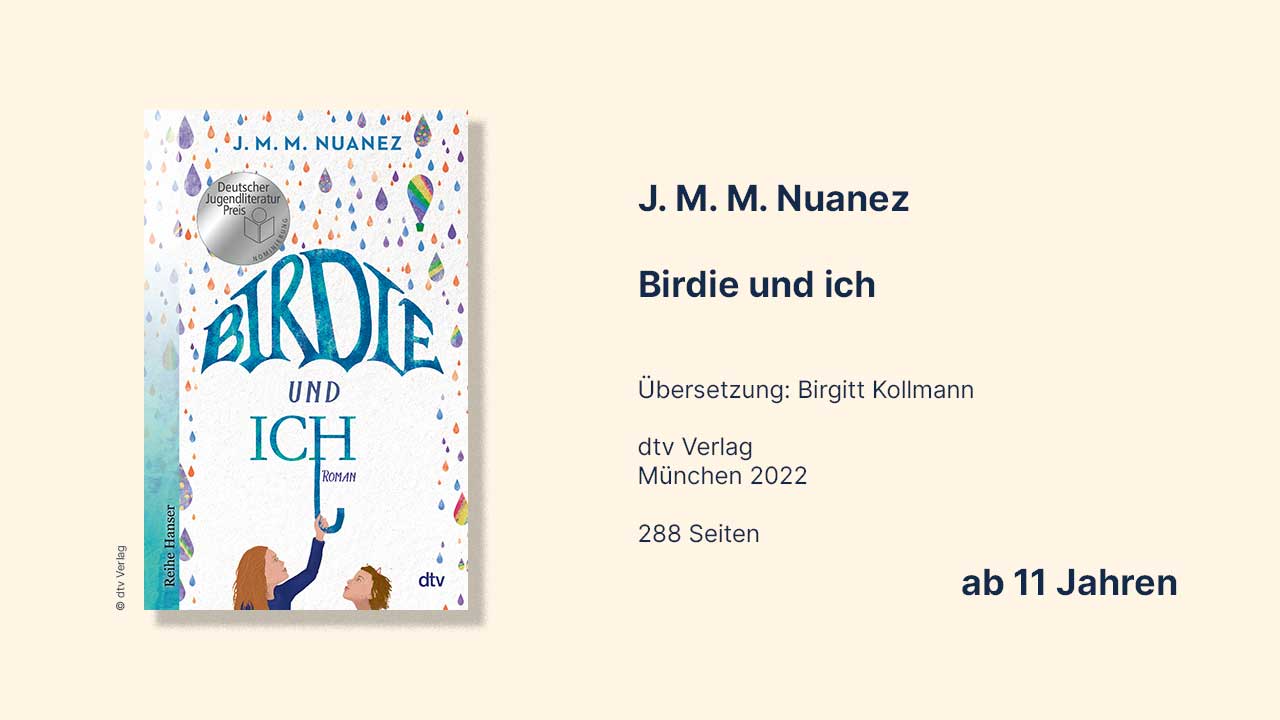
Schreibe einen Kommentar